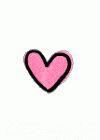Entwicklung von Schönheitsidealen
Schönheitsideale sind sehr subjektive Vorstellungen von Schönheit einer jeweiligen Zeit. Unser heutiges ausgepägt schlankes Schönheitsideal ist historisch gesehen nicht besonders alt und hat hoffentlich auch in diesem neuen Jahrtausend keinen allzu langen Bestand. Dieser Text soll einen kleinen Überblick über die unterschiedlichen Schönheitsideale in der Geschichte geben.
Von der Altsteinzeit bis zum Viktorianischen Zeitalter
Die ersten Darstellungen, die für diese Betrachtung relevant sind, stammen aus der jüngeren Altsteinzeit. Beispielhaft läßt sich die berühmte Venus von Willendorf anführen. Ihre Formen lassen sich als sehr üppig beschreiben, mit großen, hängenden Brüsten, dicken Beinen, rundem Bauch und Hinterteil. Möglicherweise symbolisiert diese Figur die Fruchtbarkeit und Ursprünglichkeit der Mutter der Erde.
In der griechischen Klassik entsprechen die Darstellungen dem Zeitgeist: Das Streben nach körperlicher und geistiger Harmonie drückte sich in einem Schönheitsideal aus, das eine vollkommene Körperform suchte. Diese "ästhetische Vollkommenheit" wurde durch ausgewogene Proportionen und Haltungen ausgedrückt. Für heutige Begriffe ist dieses Schönheitsideal aber eher als stämmig zu bezeichnen.
In der Renaissance sowie im Barock bevorzugte man mehr und mehr üppige und volle Körper, was als sinnlich-verlockend galt. Dies wurde durch die Kleidermode sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern noch verstärkt.
Im Viktorianischen Zeitalter kam dann die Wespentaille in Mode, die durch das Korsett künstlich erzeugt wurde. Hier wurde durch entsprechende Kleidung das Ideal "schmale Taille" verstärkt; darunter waren die Formen weiblich-üppig.
Das 20. Jahrhundert
Zu Beginn des 20. Jh. gehörten noch üppige Busen und Dekolletés zum Schönheitsideal, doch schon in den 20er Jahren kam die erste Schlankheitswelle auf. Die Frauen emanzipierten sich: Im Krieg hatten sie gelernt, auch ohne ihre Männer für sich und ihre Kinder zu sorgen, und diese neue Selbständigkeit wollten sie nicht mehr aufgeben.
Im Kampf um die Gleichberechtigung wurde eine androgyne Figur angestrebt, sehr schlank und mit kurzem Haarschnitt. Möglicherweise hängt dies damit zusammen, daß die Frauen ihren weiblichen Körper bewußt oder unbewußt verbergen wollten, um in der Männergesellschaft Fuß zu fassen.
Im Zweiten Weltkrieg waren die Formen dann wieder üppiger. Es wurde die neue Weiblichkeit propagiert, die vor allem auf die Aufgabe der Mutterschaft hinwies. Die NS-Ideologie schrieb die Rolle der Frau auf die biologische Funktion des Kinder bekommens fest. Zu diesem Zweck war es sinnvoll, weibliche Formen zu betonen.
Die Nachkriegszeit als eine Zeit des Mangels und der Entbehrungen ließ auch weiterhin volle, gut genährte Körper als erstrebenswert erscheinen, zeugte dies doch von Reichtum. Es wurden sogar gepolsterte BH`s getragen, um dem Körper mehr Fülle zu verleihen.
In den 60er Jahren vertraten rassige Frauen mit langen Beinen, schmaler Taille und viel Busen das Schönheitsideal; Frauen wie Sophia Loren oder auch Marilyn Monroe. Letztere war mit Kleidergröße 44 durchaus gut gebaut. Am Ende dieses Jahrzehnts wurde dann das Model Twiggy berühmt, das mit seinen Körperformen an eine Magersüchtige erinnert. Diese als androgyn zu bezeichnende Figur fällt zeitlich zusammen mit der aufkommenden Studentenbewegung, die gesellschaftliche Umwälzungen forderte und der feministischen Bewegung zu einem Aufschwung verhalf. Die Motivation, Kinder zu bekommen, sank allgemein. In den achtziger Jahren wurden wieder etwas weiblichere Formen mit der Twiggy-Figur kombiniert. Busen sollte wieder sei, dabei sollte aber eine schlanke Taille und wenig Hüfte weiterhin beibehalten werden. Dieses Schönheitsideal kann nur von wenigen hochbezahlten Modells eingehalten werden, dient aber immer noch als Vorbild für viele Frauen.
Beim Betrachten des Wandels des Schönheitsideals in diesem Jahrhundert fällt auf, daß Frauen immer dann schlank sein sollten, wenn sie sich emanzipierten und Gleichberechtigung forderten. "Weiblich-üppig" waren sie besonders in Zeiten des Mangels und in Zeiten, in denen ihre Gebärfähigkeit gebraucht wurde.
Insgesamt zeigt sich aber, dass sich Schönheitsideale im Laufe der Jahrzehnte durchaus gewandelt haben und in keinster Weise statisch sind. Wie viele subjektiven Modeerscheinungen verhält sich auch das "Figurideal" pendelartig. Der Pendel bewegt sich zeitweise eher hin zum rundlicheren Schönheitsideal um dann wieder in die andere Richtung auszuschlagen. Die derzeitigen magersüchtigen Modells und der sich langsam äußernde Protest dagegen, lassen hoffen, dass das Pendel sich wieder zurück zu runderen Formen bewegen kann.
Bilder in unseren Köpfen
Schlankheitsideale entstehen natürlich nicht dadurch, dass sie von irgendwem festgelegt werden. Sie werden maßgeblich beeinflusst von Bildern, die uns Tag für Tag begegnen und die sich gegenseitig verstärken. Eine wesentliche Rolle spielen dabei in unserer Mediengesellschaft die Medien selber. Diese tragen in nicht unerheblichen Maße zur Stigmatisierung und Diskriminierung von dicken Menschen bei. Im Film, in Zeitschriften und in der Werbung dominieren durchweg schlanke Frauen, es entsteht der Eindruck, daß es keine Frauen mit einer anderen Figur gibt.
Im Bereich des Films gibt es so gut wie keine dicken Schauspielerinnen, die Charakterrollen spielen, die unabhängig von ihrem Gewicht sind. Dicke Frauen spielen mit wenigen Ausnahmen nur Rollen, in denen sie ungeschickt sind, oder in denen sie bestraft werden. Ausnahmen, wie beispielsweise Marianne Sägebrecht, bestätigen da eher die Regel.
In Zeitschriften wird immer von einem schlanken Ideal ausgegangen, mit dem auch bestimmte Eigenschaften verbunden werden. Derzeit sind dies Eigenschaften wie "Natürlichkeit, Authentizität und Spontaneität". Unwillkürlich entsteht bei der Leserin der Wunsch auch schlank zu sein, um die dargestellten Eigenschaften selbst umzusetzen.
Es gibt so gut wie keine Modetips für dicke Frauen; alle Models sind schlank, d.h. sie tragen maximal Größe 38. Selbst wenn es spezielle Mode für dicke Frauen gibt, wird diese von Models vorgestellt, die Größe 42/44 haben, was ich nicht als dick bezeichnen möchte. Das bedeutet, daß sich dicke Frauen mit dem in Frauenzeitschriften Präsentierten nicht identifizieren können; sie werden als Gruppe, die sich für Mode interessiert, einfach ignoriert. Statt dessen gibt es immer wieder Diätvorschläge, die dicken Frauen den Weg zum Idealgewicht ebnen sollen. Damit wird der Zustand des Dickseins als nicht erstrebenswert dargestellt, muß er doch verändert werden.
Als Beispiel, wie "leicht" das Abnehmen ist, werden Frauen gezeigt, die durch eine Diät viel Gewicht verloren haben. Die "Vorher-Nachher-Bilder" machen den Unterschied deutlich. Das "Vorher-Bild" zeigt den Schnappschuß einer dicken Frau, die nicht geschminkt ist und meist auch sehr unglücklich aussieht. Das "Nachher-Bild" zeigt eine schlanke Frau, perfekt gestylt, die einen zufriedenen, glücklichen Ausdruck im Gesicht hat. Damit wird die dicke Frau gleich doppelt stigmatisiert: Auf der einen Seite spricht man ihr ab, mit einem solchen Gewicht glücklich sein zu können, auf der anderen Seite wird unterstellt, daß die dicke Frau ungepflegt sei, denn im Vergleich zu ihrem neuen schlanken Ich kommt sie viel schlechter weg. Durch solche Darstellungen wird dicken Frauen selbst die Schuld am Zustand ihres Körpers gegeben, da es ja andere Frauen geschafft haben abzunehmen.
Auch in der Werbung ist kein Platz für dicke Frauen. Die Frau in der Werbung soll als Blickfang dienen und zum Kaufen anregen. Durch sie wird das angebotene Produkt mit angenehmen Reizen verknüpft, die es selbst nicht hat.
Scheinbar werden nur schlanken Frauen angenehme Reize zugesprochen, denn dicke Frauen sind in der Werbung nicht oder nur mit negativen Assoziationen zu finden.
Es ist deutlich geworden, daß in den Medien die dicke Frau weitgehend ignoriert, oder aber mit negativen Eigenschaften belegt wird.
© Gisela Enders, Kassel 1999